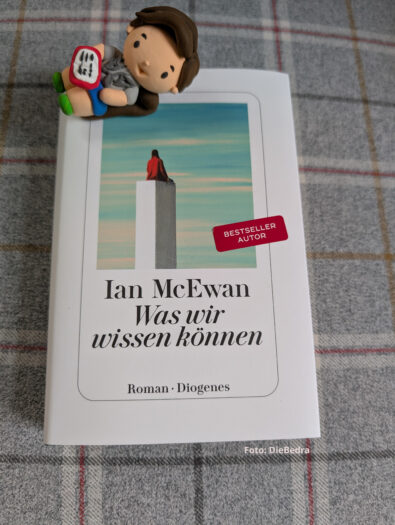Wir befinden uns im Großbritannien des Jahres 2119. Die einstige Seemacht besteht nur noch aus einer Ansammlung schlecht organisierter kleiner Inseln und ist mindestens genauso trist wie der Rest der Welt. In dieser werden die USA von Warlords beherrscht und Russland hat sich den Teil Europas einverleibt, der nicht im Wasser versunken ist. Die wirkliche Großmacht in dieser Zeit allerdings ist Nigeria.
„Mary Sheldrake war eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen ihrer Generation.“
Vor allem die Teile der Bibliotheken, die die von einer fehlgesteuertem KI ausgelösten Atomkriege und die folgenden Flutwellen überstanden haben, wurden von den Briten – ganz die Buchliebhaber – auf hoch gelegene Teile ihres verbleibenden Landes gerettet.
Denn unter anderem Oxford, die wie kein zweite Stadt für ihre universitäre Studien und intellektuelles Leben steht, ist komplett versunken. Seine Gebäude werden wohl allmählich von Wasser zerstört.
„Diese diverse Disruptionen fügten sich für sie nicht zu einem größeren, besorgniserregenden Muster zusammen, das auf Klimawandel oder eine aus den Fugen geratene Natur verwies.“
Thomas Metcalfe ist in dieser Welt des Jahres 2119 Literaturwissenschaftler, der sich hauptsächlich mit den Werken der Zeit zwischen 1990 und 2030 beschäftigt. Und er will herausfinden, ob sich die damaligen Schriftsteller mit den aufziehenden ökologischen und politische Katastrophen beschäftigt haben. Vor allem aber ist er an einem Sonettenkranz seines Lieblingsautoren Francis Blundy interessiert. Dieser hat das Gedicht 2014 bei einem Abendessen mit Freunden seiner Frau Vivien gewidmet und es vorgetragen. Nach allem, was man weiß, wurde es nie veröffentlicht und gilt seither als verschollen. Thomas Metcalfe will herausfinden, was mit dem Gedicht passiert ist und es wenn irgend möglich finden.
„Das Gedächtnis ist wie ein Schwamm. Es saugt Material von anderen Zeiten, anderen Orten auf und träufelt es über den fraglichen Augenblick.“
Ian McEwan beschreibt in „Was wir wissen können“ unsere Gegenwart als eine Zeit, die im Rückblick aus dem Jahr 2119 wie ein Paradies erscheint. Zwar schwindet der Artenreichtum an Flora und Fauna. Es gibt aber noch eine Vielzahl an Tieren und Pflanzen, die aus dem Rückblick für den Literaturwissenschaftler unvorstellbar scheint. Und zumindest die Menschen in Großbritannien leben in Sicherheit und Frieden und nehmen die demokratische Freiheit als Selbstverständlichkeit an.
„Vivien (hielt) im Lauf ihrer Jahre in der Scheune auch häufig Wetterbeobachtungen fest. Dass mehrere milde Winter aufeinanderfolgten, bedrückte sie.“
Was eine düstere Dystopie und ein Abgesang auf die Welt, wie wir sie kennen, sein könnte, macht Ian McEwan zu einem Roman, der trotz allem Zuversicht ausstrahlt und ein wahres Lesevergnügen ist. Das liegt nicht nur an der Handlung, die sich allmählich aber keineswegs langweilig entwickelt. Es liegt auch an einer grundlegend optimistischen Haltung, die der große britische Autor seinen Figuren – allen voran Thomas Metcalfe – mitgibt. Denn selbst in einer Zukunft, die sich von einem verheerenden Krieg erholt, haben Bücher überlebt, werden gelesen und wissenschaftlich erforscht.
Wie so oft bei Ian McEwan versinkt man lesend in seinen Geschichten, betritt einen Raum außerhalb der Zeit, den man nur ungern verlassen möchte. Zum Glück hat „Was wir wissen können“ 468 Seiten.
Ian McEwan: Was wir wissen können, Diogenes, 28 Euro. Aus dem Englischen von Bernhard Robben.
Das Buch wurde mir freundlicherweise vom Verlag zur Verfügung gestellt.